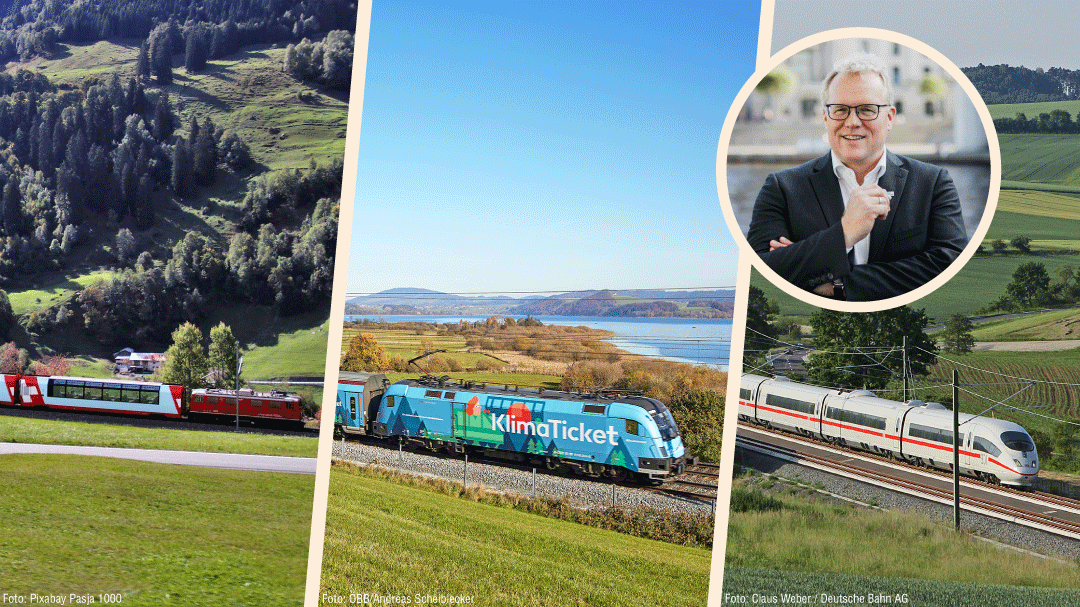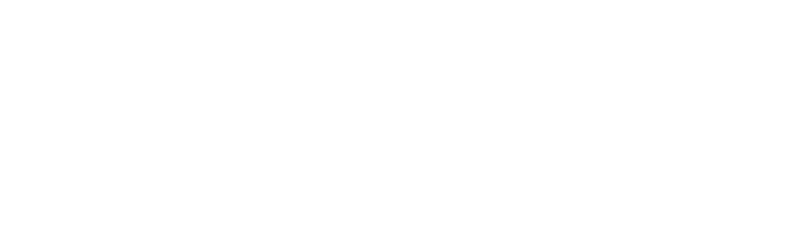Wie sollte die Schieneninfrastruktur in Zukunft finanziert werden?
Verbändepapier zur Weiterentwicklung der Finanzierungssystematik Schiene
Aus- und Neubau des Schienennetzes soll sich nach dem Willen von Union und SPD am Deutschlandtakt orientieren. Für die Umsetzung soll es künftig zusätzlich einen Infraplan geben. Sieben Bahnverbände sehen diesen Infraplan als „Leitinstrument“ zur strategischen Steuerung der DB InfraGO durch den Bund und fordern eine neue Finanzierungsarchitektur bei der Finanzierung der Bundesschienenwege.
Infrastruktur-Sondervermögen eine Chance
Das beschlossene Infrastruktur-Sondervermögen ist eine Chance, den in jüngster Zeit begonnenen Hochlauf der Schieneninfrastruktur-Investitionen mit zusätzlichen Mitteln fortzusetzen und künftig auf einem hohen Niveau zu verstetigen.
Der Reformbedarf geht aber über eine deutliche Anhebung des Investitionsniveaus hinaus. Um Kapazität, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Schienennetzes spürbar und rasch zu erhöhen, bedarf es einer Weiterentwicklung der Finanzierungssystematik für die Schieneninfrastruktur. Entscheidend sind dabei eine Bündelung der Finanzierungsquellen, eine deutliche Reduzierung der Komplexität von Finanzierungsverträgen und Zuwendungsregeln, eine überjährige Planbarkeit und Verlässlichkeit der Mittelbereitstellung sowie eine zielgerichtete Steuerung der Infrastrukturentwicklung durch den Bund.
Anforderungen an die Weiterentwicklung der Finanzierungssystematik
Aus Sicht der unterzeichnenden Verbände des Bahnsektors sollte die anstehende Reform folgenden Anforderungen gerecht werden:
Der Bund muss Verantwortung übernehmen
- Nötig ist eine klare Leitstrategie des Bundes für die Infrastrukturentwicklung, die deutlich mehr Verkehr auf der Schiene möglich macht bei hoher Qualität und Zuverlässigkeit. Basis dafür ist der Deutschlandtakt, der durch ein stufenweises Umsetzungskonzept (Etappierungskonzept) konkretisiert werden muss.
- Verbindlichkeit bei der Umsetzung von Sanierung und Ausbau im Schienennetz:
Der Bund muss ein verbindliches und mit Umsetzungszeiträumen versehenes Maßnahmenportfolio samt der dafür erforderlichen Finanzierung vorlegen. - Klare Rollenverteilung zwischen Bund und DB bzw. Sektor:
Bund muss federführend die gewünschte Schieneninfrastruktur (Umfang, Leistungsfähigkeit und Qualität) definieren, finanzieren und über Kennzahlen steuern. Hierzu muss er auch kapazitativ und inhaltlich in der Lage sein. Der Bund agiert damit im Rahmen eines Offertenmodells als Infrastruktur-Besteller gegenüber der DB InfraGO (Orientierung am Schweizer Vorbild). Die DB InfraGO verpflichtet sich dementsprechend die Infrastruktur effizient und zuverlässig bereitzustellen und zu betreiben. Eine höhere Kosteneffizienz muss die DB InfraGO unter anderem durch Überprüfung von nicht sicherheitsrelevanten Standards und Straffung interner Prozesse erreichen.
Infraplan wird Leitinstrument
- Leitinstrument der Umsetzung muss ein gesetzlich verankerter „Infraplan“ werden, der verbindliche Entwicklungsschritte (abgestimmte Verbesserung der Netzzustandsnoten, Maßnahmenportfolio) für die Schieneninfrastruktur mit einem Fünfjahres-Horizont (Minimum) und jährlicher Fortschreibung formuliert.
- Im Infraplan als Leitinstrument werden sowohl Bestandserhalt, Sanierung und Modernisierung als auch Aus- und Neubau verbindlich festgelegt. Der Infraplan ist die Basis für eine vertragliche Regelung zwischen dem Bund als Infrastruktur-Besteller und der DB InfraGO, in der Umsetzung und Finanzierung des Maßnahmenportfolios für die gesamte Laufzeit des Infraplans fixiert werden. Ebenso wie der Infraplan selbst wird auch die vertragliche Regelung zwischen Bund und DB InfraGO jährlich um ein weiteres Jahr fortgeschrieben.
Finanzierung muss überjährig und verbindlich festgeschrieben sein
- Der Gesamtfinanzierungsbedarf für alle Maßnahmen des Infraplan (d.h. für Bestandserhalt, Sanierung, Modernisierung sowie für Aus- und Neubau) muss bundesseitig überjährig und verbindlich durchfinanziert und abgesichert sein. Wie der Infraplan selbst muss auch der Gesamtfinanzierungsbedarf jährlich fortgeschrieben und verbindlich abgesichert werden.
- Eine verbindlich durchfinanzierte Umsetzung des Infraplan erfordert eine stärkere Bündelung der Finanzierungsquellen für die Schieneninfrastrukturinvestitionen. Für einen effizienten Mitteleinsatz muss die Komplexität von Finanzierungsverträgen und Zuwendungsregeln deutlich reduziert werden. Die ergänzende Finanzierung aus einem Sondervermögen muss einem einheitlichen Mittelabruf trotz unterschiedlicher Finanzierungsquellen folgen sowie eine überjährige Durchfinanzierung aller Maßnahmen des Infraplans beinhalten.
- Teil der Infrastrukturfinanzierung Schiene ist die Nutzerfinanzierung durch Infrastrukturentgelte. Hier muss der Bund den bestehenden Regulierungsrahmen reformieren und einen größeren Anteil der Infrastrukturkosten übernehmen, mit dem Ziel, die Infrastrukturentgelte auf die unmittelbaren Kosten der Zugfahrt („Grenzkosten“) zu begrenzen und für die Nutzer längerfristig planbar zu machen. Hierzu gehört auch, dass der Bund bei der Finanzierung von Schieneninvestitionen anstelle von Eigenkapitalerhöhungen wieder zu Baukostenzuschüssen als alleinigem Instrument der Infrastrukturfinanzierung zurückkehrt.
Wie unterscheidet sich der Infraplan vom Bundesverkehrswegeplan (BVWP)?
Ein gut gemachter Infraplan sollte künftig die zentrale Grundlage für die Entwicklung der Schieneninfrastruktur sein. Der Bundesverkehrswegeplan wird weiterhin existieren. Die Steuerung und Umsetzung des Erhalts und Ausbaus der Schiene wird jedoch durch den Infraplan erfolgen.
Fokus: Der BVWP betrachtet Schiene, Straße und Wasserwege, während der Infraplan sich nur auf die Schiene bezieht.
Umfang: Der BVWP listet lediglich Aus- und Neubauprojekte auf, während der Infraplan auch Bestandserhalt, Aus- und Neubau, Sanierung und Modernisierung umfasst.
Verbindlichkeit: Der BVWP ist keine verbindliche Umsetzungsplanung, sondern eine Sammlung von Projekten ohne konkrete Realisierungszeiträume. Der Infraplan hingegen würde ein Arbeitsprogramm mit gesicherter Finanzierung für mindestens fünf Jahre definieren, das jährlich um ein weiteres Jahr fortgeschrieben wird.
Entwicklungs- und Qualitätsziele: Während der BVWP keine umfassenden Ziele für die Infrastrukturqualität formuliert, würde der Infraplan klare Maßstäbe für die zukünftige Netzentwicklung setzen.